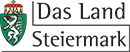Katastrophenschutzreferenten-Treffen in Judenburg
Von der Notfall- und Katastrophenmedizin bis zu den Ressourcen der Luftabwehr

Die Abteilung 20 des Landes Steiermark legte mit einem umfangreichen und informativen Programm gemeinsam mit dem Katastrophenschutz-Referenten der BH Judenburg Dietmar Kaiser einen weiteren Grundstein für die erfolgreiche Aus- und Fortbildung der steirischen Katastrophenschutzreferenten.
In einer eindrucksvollen Eröffnungsrede, untermalt mit Fakten, Daten und Sehenswürdigkeiten aus der dortigen Region, stellte HR Mag. Ulrike Buchacher „ihren" Bezirk Judenburg vor. Der Katastrophenschutz und das behördliche Krisenmanagement mit den Zielvereinbarungen für das Jahr 2010, wie beispielsweise die Aktualisierung der Pandemiepläne oder Stabstrainingskurse innerhalb der Verwaltung, galten als zentrale Aufgaben. Auch der Bezirk Judenburg war in den letzten Jahren geprägt von Katastrophen, allein im Jahr 2009 war in diesem Bezirk ein durch Katastrophen verursachtes Schadensausmaß von rund € 600.000 zu verzeichnen.
HR Dr. Kurt Kalcher, der Leiter der Abteilung 20 Katastrophenschutz und Landesverteidigung, betonte in seinen Begrüßungsworten die außergewöhnlich gute kooperative Zusammenarbeit mit den Bezirksverwaltungsbehörden. „Durch die Zusammenarbeit auf gemeinsamer Ebene können wir Fachwissen und Ressourcen gemeinsam nutzen und besser gerüstet sein", so der Leiter der Abteilung.
In der Steiermark wurden neue, moderne Wege im Katastrophenschutz eingeschlagen. Großflächige Gefahrenlagen können nur bewältigt werden, wenn die beteiligten Akteure über Bezirksgrenzen hinweg zusammenarbeiten und wenn die Katastrophenschutzabteilung die Gemeinden und Bezirksverwaltungsbehörden bei der Vorbereitung auf solche Gefahren und deren Bewältigung unterstützt. Diesbezüglich wird auf EU-Ebene eine Richtline für das Risikomanagement in den nächsten Wochen herausgegeben und werden alle EU-Staaten beauftragt, noch vor Ende 2012 nationale Risikoanalysen durchzuführen. Die Zuständigkeit und Verantwortung für den Katastrophenschutz liegt jedoch bei den Bundesländern und werden daher in weiterer Folge die lokalen Katastrophenschutzbehörden, insbesondere die Katastrophenschutzreferenten, dahingehend gefordert sein.
Der Leiter der Koordinationsstelle für Notfall- und Katastrophenmedizin der Abteilung 20, Prim. Dr. Klaus Pessenbacher, referierte über die Notarztsysteme in der Steiermark. Die Steiermark verfügt über 21 bodengebundene Notarztstützpunkte, die sowohl vom Land, aber auch von Städten und Gemeinden finanziert werden. 6000 Sanitäter, davon rund 600 Notfallsanitäter und mehr als 200 Notärzte versorgen mit 2 Notarzthubschraubern des ÖAMTC und rund 500 Rettungs- und 30 Notarztfahrzeugen Patienten in der Steiermark. Im Jahr 2009 wurden 17.000 bodengebundene und 1400 Luftrettungen durchgeführt. Eindrucksvoll sind auch die Interventionszeiten: In 80 % der gefahrenen Einsätze ist der Notarzt in weniger als 15 Minuten am Einsatzort. Diese Daten werden von der sogenannten „zentralen Notfalldatenbank" der Koordinationsstelle für Notfall- und Katastrophenmedizin erfasst und ausgewertet. Zu den weiteren, umfangreichen Aufgaben dieser Koordinationsstelle gehören die Koordination der steirischen Rettungsdienste, die Adaptierung von Einsatzplänen bis hin zum präventiven medizinischen Katastrophenschutz. Dazu werden die neuesten Techniken auf dem Weltmarkt eingesetzt und gemeinsam mit dem steirischen Roten Kreuz stehen seit kurzem Planspiele in virtueller Realität auf dem Programm. Landesrettungskommandant Mag Dr. Peter Hansak stellte die aufwendige "Virtual Reality"- Trainingssoftware den Teilnehmern der Tagung vor. Diese moderne Software dient der Ausbildung und Übung von Einsatzkräften der Rettungsdienste auf operativer und taktischer Ebene und bietet Einsatzkräften die Möglichkeit, sich mit Hilfe eines Joysticks im simulierten Einsatzort, ob zu Fuß, mit einem Fahrzeug oder per Hubschrauber zu bewegen. Das Erkunden und die Lagebeurteilung kann somit in virtueller Realität trainiert werden.
Der Leiter der Stabsstelle BOS-Digitalfunk der Abteilung 20, Harald Schwab, verschaffte den Teilnehmern einen Überblick über die Entstehungsgeschichte des Katastrophenfunks und den aktuellen Stand des BOS-Projektes. Analoge Funksysteme können bei den hohen Anforderungen im Katastrophenschutz nicht mehr schritthalten und so wurde mit Regierungsbeschluss vom 28.06.2010 die Grundlage für die angehende Errichtung von rund 350 Funkbasisstationen für die Funkinfrastruktur BOS-Digitalfunk in der Steiermark geschaffen. Mit der Fertigstellung im Jahr 2013 wird eine bessere Zusammenarbeit bei der Bewältigung von Gefahrensituationen, da notwendige Maßnahmen mit dem Digitalfunk-BOS wesentlich rascher und effizienter ergriffen werden können, geboten.
Von diesem Umstand werden bis auf Gemeindeebene alle im Katastrophenschutz tätigen Einsatzorganisationen zum Schutz der Bevölkerung profitieren.
Michael Keller, Leiter des Referates Projektmanagement in der Abteilung 20 referierte über den aktuellen Stand der vorhandenen behördlichen digitalen Instrumentarien zur Bewältigung einer Katastrophe. Dazu gehören der Online-Katastrophenschutzplan und das Elektronische Einsatztagebuch ETB, modernste Computersoftware-Programme, die es den Katastrophenschutzbehörden ermöglichen, die notwendigen behördlichen Maßnahmen im Katastrophen- bzw. Ereignisfall wesentlich rascher und effizienter zu ergreifen.
LWZ- Leiter RR Ing. Gerald Pizzera gab den Teilnehmern der Tagung einen chronologischen Überblick über die erste Landeswarnzentrale Österreichs, die „LWZ Steiermark". Am 1. Oktober 1985 ging die damals österreichweit erste Landeswarnzentrale in Betrieb. Sie war Vorbild für die zwei Jahre danach entstandene Bundeswarnzentrale und alle nachfolgenden Landeswarnzentralen. Seit nunmehr 25 Jahren ist diese ein wichtiges Bindeglied zwischen Einsatzkräften, Bezirkshauptmannschaften und der Landesregierung. Seit dieser Zeit wurden und werden unzählige Katastrophenszenarien - nicht nur in der Steiermark - über die Landeswarnzentrale abgewickelt. Sie ist die behördliche Informationsdrehscheibe der Steiermark, die darüber hinaus die zentrale Einlaufstelle für Notrufe der Bergrettung und somit Dreh- und Angelpunkt der alpinen Hilfe ist. Am 21. September diesen Jahres wurde nunmehr die neu gestaltete Landeswarnzentrale im feierlichen Rahmen mit Landeshauptmann Mag. Franz Voves ihrer Bestimmung übergeben.
In einem beeindruckenden Vortrag illustrierte der Katastrophenschutzreferent der Bezirkshauptmannschaft Liezen, Hans-Peter Scheb, seinen Kollegen die Bewältigung der Unwetterkatastrophe im Sölktal. Von den rund 370 Hektar Nutzfläche im Kleinsölktal und Sattental waren 171 Hektar von dem Ereignis betroffen. 400.000 m³ Geröllmassen verschütteten den Talboden, 40.000 Festmeter Holz wurden ins Tal gespült, 13 Brücken und zwölf Kilometer Straße wurden zerstört. Die Flutwelle verwüstete auch 50 Wohnobjekte und Wirtschaftsgebäude, 67 Personen waren eingeschlossen, 55 von ihnen wurden evakuiert. 14 Almen waren nicht erreichbar und mussten zur Gänze mit Lebensmittel Wasser, Treibstoff, etc. versorgt werden. Bis zu 230 Bundesheerangehörige (pro Tag) standen im Katastrophengebiet im Einsatz mit insgesamt 90.000 Arbeitsstunden und mehr als 15.000 zurückgelegten Kilometern mit Heeresfahrzeugen. 18 km Straßen wurden freigelegt, 6 Hofzufahrten und 7 km Straßen wiederhergestellt, 1727 durchgeführte Hubschrauberflüge mit mehr als 114 Stunden Flugzeit, 1060 Passagiere und 25.280 kg an Lasten wurden transportiert.
Die Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Liezen als zuständige Katastrophenschutzbehörde leisteten in Spitzenzeiten rund 900 Arbeitsstunden. Dem Katastrophenschutzreferenten und Einsatzleiter Hans-Peter Scheb oblag die Gesamtkoordination, die Anforderung aller Assistenzleistungen und Auftragserteilung an Assistenzleister, sowie die Verwaltung, aber auch die Zuteilung und Abrechnung der Soforthilfemittel. Die Aufnahme der Schadensfälle in allen betroffenen Gemeinden und die Bewertung derselben sowie die Prognose über die Schadenshöhe.
Umrahmt wurde das Programm des ersten Seminartages vom Leiter des Referates II/4/a (Bundesministerium für Inneres), Mag. Siegfried Jachs, der über das Krisenmanagement der EU und dessen Umsetzung auf nationaler Ebene und Länderebene referierte. Den Teilnehmern der Tagung wurde ein Überblick über die Inhalte und Entwicklung des EU-Katastrophenschutzes gegeben. Ebenso erwähnt wurden das Gemeinschaftsverfahren für grenzüberschreitende Einsätze und der gemeinschaftliche Präventionsrahmen. Letzterer beinhaltet die Entwicklung von Gemeinschaftsrichtlinien für Gefahren- und Risikokartierungen, sowie die Risikobewertung und -analyse im Katastrophenschutz.
Das österreichische Bundesheer mit seinen Streitkräften im Bezirk Judenburg war Themenschwerpunkt des zweiten Seminartages. Kasernenkommandant und Kommandant des Fliegerabwehrregiments Zeltweg, Oberst Edwin Pekovsek, gab den Teilnehmern der Tagung einen Überblick über die Ressourcen der Luftabwehr und Luftraumüberwachung des Österreichischen Bundesheers. Eine Besichtigung des Eurofighters, die Vorstellung der Ressourcen der Flugabwehr und der Besuch des Fliegermuseums in Zeltweg bildeten die Höhepunkte des Vormittagprogrammes.
Oberst Dieter Allesch, Kommandant des Truppenübungsplatzes Seetaler Alpen, referierte am Nachmittag über die aktuelle wehrpolitische Situation in Österreich. Ebenso wurden die Daten und Fakten des TÜPL Seetaler Alpen vorgetragen. Bereits die k.u.k. Österreichisch-Ungarische Armee verwendete die Seetaleralpen als militärisches Übungsgebiet. Inzwischen ist der Truppenübungsplatz einer der modernsten militärischen Übungsplätze Europas geworden und wird von vielen internationalen Armeen zu Übungszwecken verwendet.
Die Folien-Vorträge der Referenten können im geschützten Bereich des Katastrophenschutzplan-Online-Portals abgerufen werden!
Für Rückfragen steht Ihnen als Verfasser bzw. Bearbeiter dieser Information
Günter Hohenberger unter Tel.: +43 (316) 877- 4549, bzw. Mobil: +43 (676) 86664549 oder E-Mail: guenter.hohenberger@stmk.gv.at zur Verfügung